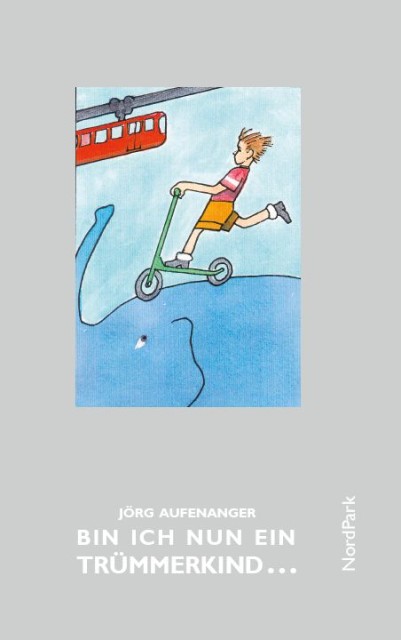N O R D P A R K
 V E R L A G |
Startseite | Der NordPark-Buchladen | Die Autoren | Gesamtüberblick |
Impressum & Datenschutz
Suchen im NordPark Verlag:

Jörg Aufenanger
Bin ich nun ein Wirtschaftswunderkind
Augenblicke aus der Wunderzeit
Paperback
176 S.; 2014; EUR 10,50;
ISBN: 978-3-943940-02-2
Leseprobe
bestellen
Ausführliche Leseprobe (pdf-Datei)
»Ja was, ja wer bin ich gewesen, dass ich so geworden bin, wie ich bin? Wie nah, wie fern bin ich dem, der ich einmal war?«
In 39 Skizzen erinnert Jörg Aufenanger sich an die Jahre, die ihn formten und veränderten. Vom Ruhrpott in Dortmund in den fünfziger und sechziger Jahren, den Wunderjahren der neuen Republik, über den Sehnsuchtsort Riviera bis in die aufrührerischen Jahre in Paris und Berlin. Ein Porträt einer Zeit und einer Generation, die dem Muff der frühen Republik zu entfliehen sucht in eine neue politische Haltung und freiere Erotik. Und auf dem Weg die Literatur, Kunst und Musik entdeckt und gestaltet ...
Leseprobe
1
Bin ich nun ein Kind des Wirtschaftswunders, da ich in den 1950/60er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine ungetrübt geglückte frühe Jugend hatte? Ich war doch auch kein Trümmerkind gewesen, nur weil ich in den ersten Nachkriegsjahren zwischen Trümmern gespielt und dort meine ersten erotischen Erlebnisse hatte. Bin ich vielleicht nur ein Piratenjunge gewesen, da ich häufig eine schwarze Augenklappe trug? Oder war ich vor allem ein sonderlicher Einzelgänger, der die Jahre von Kindheit und früher Jugend mehr oder weniger allein durchlebt hat?
In den ersten Nachkriegsjahren habe ich zwar zwischen Trümmern gespielt, doch ein Trümmerleben gab es für mich in dem vom Bombenkrieg verschonten gutbürgerlichen Zooviertel von Wuppertal nicht, in dem nur eine einzige verirrte Bombe für unseren Abenteuerspielplatz gesorgt hat. Mein Kinderleben war eine Idylle.
Das Wirtschaftswunder hat keine Spur in mir hinterlassen. Meine Mutter und ich lebten, als wir von Wuppertal ins Ruhrgebiet übergesiedelt waren, stets bescheiden, in einfachen Verhältnissen wie man so sagt, denn meine Mutter erhielt keine prall gefüllte Lohntüte. Eine karge Sozialwohnung war das neue Zuhause. Es gab keine Heizung, Waschmaschine und Fernseher fehlten ebenso wie ein Auto, all jene Bescherungen und Symbole des Wirtschaftswunders. Und eine gemütliche Familienidylle von Vater, Mutter und zwei Kindern wie in den Jahren üblich gab es für mich auch nicht, denn meine Muter war wie man heute sagt eine Alleinerziehende und ich weiterhin ein Schlüsselkind. Ich vermisste dennoch nichts in meinem frühen Jugendglück.
War ich denn nun ein Piratenjunge, weil ich im Alter von zehn Jahren eine schwarze Augenklappe getragen habe? Sie war eine Qual, ich wollte nie Pirat werden und Piratenspiele habe ich ebenso verachtet, wie das Piratenkarnevalskostüm. Aber ich musste die Augenklappe tragen, denn sobald ich im Ruhrpott lebte, verklebten meine Augen, und an manchem Morgen sah ich so gut wie nichts. Es war ja noch kein blauer Himmel über der Ruhr, den versprach Bruder Johannes erst später. Bindehautentzündung, Augentropfen und über dem schlimmeren Auge mal rechts, mal links die Augenklappe. Mit der musste ich zur Schule, und der Spott war mir gewiss. Pirat, rief man mich, Einauge. Und man wollte Luftgefechte mit imaginären Säbeln mit mir austragen. Ich wendete mich ab und war den Tränen nahe, die dann auch kullerten, schon weil das freie Auge tränte.
Die Zeit in Dortmund begann als Albtraum, mein Leben in Wuppertal war bis dahin eine Glückspartie gewesen.
Doch kaum war das Auge geheilt, war alles vergessen und ich war wieder wer, der mit anderen Jungen Fußball spielte, doch es dauerte nicht lange, bis die Bindehaut sich erneut entzündete. Der Dreck von Kohle und Stahl lag in der Luft und verkroch sich in mein Auge, das ihn wie magisch anzuziehen schien. Ich war das einzige Kind, das mit einer Augenklappe rumlief, ein Makel, die anderen waren im Schmutz aufgewachsen. Ich verachtete sie deswegen. Verfluchte die Umsiedlung aus der Idylle in Wuppertal in das schwarze Loch von Dortmund. Immerhin konnte ich auch mit geschlossenen Augen Geige spielen. Der einzige Trost war die Musik.
Ein Sonderling? Da ich die Zeit in Wuppertal und vor allem in Dortmund allein ohne eine echten Freund durchlebt habe, zwar Mädchen hatte, die aber nie wie ein Junge Freund sein konnten, da sie für mich stets eine erotische Versuchung darstellten.
Was also bin ich gewesen? Bin ich der geworden, der ich schon in meiner Jugend war? Wie nah, wie fern? Schreiben, jedes Schreiben, nicht nur das ausdrückliche Schreiben über einen selbst, ist eine Selbstbefragung, eine Selbstvergewisserung. Ja, ich war eine sonderlicher Einzelgänger, bin es geblieben auf allen Stationen meines weiteren Lebens, ob in Berlin, in Paris, in Rom, immer stand ich am Rand, selbst wenn ich mittenmang war.
Aber bin ich es wirklich, über den ich schreibe, oder bin ich ein anderer als der, als den ich mich darstelle? Bin ich eine Erfindung?
2
Ich war nun knapp zehn Jahre alt, lebte plötzlich von einem Tag auf den anderen inmitten einer großen Stadt. Überall standen noch Trümmer herum in diesem Jahr 1955, sie säumten meinen Schulweg, und den in ins Zentrum von Dortmund rund um den Alten Markt. In Wuppertal hatte ich das nahezu trümmerlose Viertel meiner Kindheit selten verlassen, die Überbleibsel des Kriegs, seine Versehrungen und seine Versehrten habe ich kaum wahr genommen. Das war nun anders. Einbeinige, die sich an Krücken durch die Stadt schleppten, beinlose Männer, die auf Rollbrettern zwischen den Trümmern einherfuhren, begegneten mir. Aber es gab in Dortmund neben den Trümmern auch reihenweise Neubauten, wie das Haus, in das meine Mutter und ich einzogen. Sozialer Wohnungsbau, gerade errichtet. Für solche wie uns.
Obwohl es in Dortmund unzählige Trümmergrundstücke gab, wurden sie nicht zu einem Spielplatz wie die Jahre zuvor. Warum nicht? Es fehlte wohl die Einzigartigkeit, die die Abenteuerlust von Kindern befeuert. Trümmer galten als Relikte einer Zeit, die man so schnell wie möglich vergessen machen wollte, Schandflecke, die aber nicht als Beweis vergangener Schande galten, sondern als Orte, die das Bild der neuen Stadt, des neuen Staats und seines beginnenden Wirtschaftswunders verunzierten. Daher wurden die Trümmer nach und nach abgetragen in einem immer schnelleren Rhythmus, ich schaute mir an, wie die Gerippe der Häuser gesprengt wurden und zusammenkrachten, Staub aufwirbelten. Neubauten wurden in Eile hochgezogen, wie die in der Strasse, in der ich nun wohnte, ein seelenloses Haus neben dem anderen, Markgrafenstrasse.
In Wuppertal wohnten wir in hohen und geräumigen Zimmern eines Gründerzeithauses und mit einem Balkon. In der neuen Gründerzeit des Wirtschaftswunders lebte ich nun beengt, ja wir waren eingezwängt und zudem unter dem Dach, natürlich ohne Balkon. Mit Badewanne zwar, Heizung indes nicht, Kohleöfen. Damals habe ich die Unwirtlichkeit des Orts nicht bewusst empfunden. Doch es mag sein, dass sie mich tief geprägt hat, sodass ich später nur in Altbauten wohnen konnte, die mir Luft zu atmen ließen, weil ich mich damals eingeengt gefühlt hatte. Mein »Kinderzimmer« hatte nicht einmal einen Ofen, nur das Wohnzimmer und die Küche besaßen einen, so dass ich im Winter nicht wenig fror, abgehärtet wurde bis heute, nur bei extremer Kälte sorgte ein Heizlüfter für ein wenig Wärme.
Dennoch, mich kümmerte es nicht viel. Zumal ich wie schon in den Wuppertaler Jahren zuvor, viel auf der Strasse unterwegs war. Kinderspiele in Gruppen wie etwa »Fischer wie tief ist das Wasser« über die Strasse hinweg gab es indes nicht mehr, es fehlten nicht die Kinder, die Strassen waren schon zu stark befahren. Was aber spielten wir? Zu Hause nur? Organisierte Spielplätze gab es ja noch nicht.
Allein am Bunker, der hinter der Paul-Gerhardt-Kirche nicht weit entfernt lag, gab es Kinder, die Verstecken spielten, aber bald von größeren Jungens verscheucht wurden. Später erst sollte ich erfahren warum.
Einige Jungens spielten Fußball auf dem Hubschrauberlandeplatz am Ruhrschnellweg, zu denen ich mich gesellte, nachdem ich wochenlang am Rand gestanden hatte und nichts sehnlicher wünschte, als auch gegen den Ball treten zu können. Irgendwann überwand ich meine Schüchternheit, lief aufs Spielfeld, stürmte vor und ich konnte Tore schießen, wie ich es in Wuppertal getan hatte.
Allein und auf eigene Faust erkundete ich die neue Stadt, neues Leben macht neugierig. Mein Schulweg in die Volksschule an der Kreuzkirche war nicht weit, doch er führte in einer Viertelstunde über mehrere Strassen und Plätze, wo es überall etwas zu entdecken gab. Als ich ein Jahr später aufs Gymnasium kam, musste ich von Süd nach Nord durch die ganze Innenstadt laufen, in den Norden jenseits der Bahngleise, die die Stadt in zwei Hälften teilten. Und auf diesem Schulweg sollte es vielfach, hatte ich die Bahnunterführung hinter mich gelassen, aufregend Neues geben.
Dortmund war mit seinen Stahlwerken und Zechen eine Industriestadt. Als ich eines Tages in den Süden aufbrach, in eine völlig unbebaute Gegend, die vom Ruhrschnellweg, der Bundesstrasse 1, durchkreuzt wurde, stieß ich auf meinem blauen Roller auf Schuttberge, Feldwege und Gekrönsel, die ich geschickt umfahren musste, um nicht zu stürzen. Da färbte sich der Himmel plötzlich feuerrot. Vor Schreck warf ich den Roller hin. Weltuntergang? Von dem ich gelesen hatte, dass er irgendwann kommen würde. Ich blieb starr stehen, schaute gen Himmel. Irgendwann löste ich mich wieder, fuhr schnell zurück. Am Abend, als meine Mutter von der Arbeit nach Hause kam, die Welt aber nicht untergegangen war, fragte ich sie, warum der Himmel plötzlich rot geworden war, sie wusste es nicht, beruhigte mich aber. Am nächsten Tag fragte ich meinen Klassenlehrer in der Pause. »Thomasbirne« sagte er nur mürrisch und ließ mich allein mit der Birne, die Thomas hieß, worauf ich mir keinen Reim machen konnte. Die Thomasbirne sollte mich von da an stets faszinieren, aber auch erschaudern lassen, bis ich bei Hoesch einmal aus der Nähe erleben sollte, wie rote Glut aus ihr herausgestoßen wurde. Seitdem suchte ich jede Gelegenheit zu einer Werksbesichtigung im Stahlwerk, nur um mir das Spektakel anschauen zu können.
3
Ich war also aus dem Bergischen Land nach Westfalen verpflanzt worden. Man sprach anders. Die Wuppertaler Art und Weise, rheinisch zu sprechen, kann man nicht schön nennen, im Gegensatz zum kölschen Sprechen etwa, sie ist zu breit, zu bräsig. Ich weiß aber gar nicht, ob ich diesen Wuppertaler Slang gesprochen habe. Wahrscheinlich schon, aber gemäßigt, meine Mutter stammte ja aus einer gutbürgerlichen Familie, die etwas auf ihre Vornehmheit hielt, und sie selbst, daran erinnere ich mich schon, sprach kaum Wuppertalerisch, nur ein wenig dessen Melodie. Nun also war ich im westfälischen Ruhrpott. Der dortige Slang hat seine Eigenheiten und ich höre ihn heute noch gern, habe ihn mir, wenn auch gemäßigt, man ging ja aufs Gymnasium, angewöhnt. Er hat Sprachwitz, was man vom Wuppertalerischen nicht sagen kann.
Die eigentliche rheinische Frohnatur war in Wuppertal pietistisch gezähmt, beim Karneval kann man das gut erkennen. Er funktioniert in protestantischer Umgebung einfach nicht, und was soll man von einem Karneval halten, der vor allem an Aschermittwoch gefeiert wird, an jenem Tag, da man Asche auf sein sündiges Haupt streut, was der Pietist ja immer und sein ganzes Leben lang tut.
In Wuppertal ist der Katholik eine gefährdete Minderheit gewesen, er lebte in der Diaspora, in Dortmund schien er immerhin gleichberechtigt, auch wenn die Hauptkirche die protestantische Reinoldikirche ist, aber daneben existiert mitten in der Stadt auch die Propsteikirche, die ich indes damals nie aufgesucht habe und die in meiner Jugend von einem Propst Aufenanger geleitet wurde, was mich jahrelang irritiert hat, da ich immer wieder gefragt wurde, bist du mit dem verwandt, und ganz Schlaue scheuten nicht vor der Kalauerfrage zurück, ob ich dessen Sohn sei.
Nun gibt es auch in Dortmund keinen echten Karneval, aber das macht nichts, dafür besitzt das westfälische Ruhrpottdeutsch den trockensten Humor in Deutschland.
4
Kaum war ich mit meiner Mutter in die neue Heimat umgezogen, begann der Schlamassel mit meinem Vater, den ich gar nicht kannte. Sie habe wegen mir Wuppertal verlassen, meinte sie später einmal, ich aber wäre lieber in meinem Kinderparadies geblieben. Doch sie glaubte, für mich als uneheliches Kind wäre es leichter in einer neuen Umgebung, in der niemand uns kenne, aufzuwachsen und ich würde dort keine Verachtung spüren. Dabei hatte ich niemals in Wuppertal deswegen Argwohn verspürt. Es kam alles schlimmer. Sie schärfte mir ein, ich sollte, würde ich nach meinem Vater gefragt, sagen, er sei im Krieg gefallen. Und in der Tat wurde ich in der Schule bald nach ihm gefragt, sogleich am ersten Tag, als ich auf das Gymnasium gekommen war, und zwar als erster, da ich mit meinem Nachnamen am Anfang des Alphabets stand. Meine Personalien wurden aufgenommen und als man nun nach meinem Vater fragte, antwortete ich, er sei gefallen, doch bei den Nachfragen verhaspelte ich mich, wurde rot und schämte mich. Die Zeit im Gymnasium begann mit einer Schande und einer Beklemmung, von der ich mich nicht so schnell erholte. Wann habe ich die Wahrheit über meinen Vater, der meine Mutter kurz vor meiner Geburt schmählich verlassen hatte, überhaupt erfahren? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, ich wollte sie gar nicht wissen.
Zudem war es ein schmerzhafter Beginn gewesen. Einen Tag vor der Aufnahmeprüfung für das Gymnasium hatte ich einen Unfall. Die Straßenbahn, in der ich gestanden hatte, musste plötzlich bremsen, ich flog durch die Bahn und hatte eine klaffende Wunde an der Hand, kam ins Krankenhaus, wo man sie nähte. Am nächsten Morgen fuhr ich trotz dieser traumatischen Erfahrung wieder mit der Straßenbahn, allein, meine Mutter musste ja arbeiten, durch die Stadt in den Norden zum Helmholtzgymnasium. Unter Schmerzen. Ich kann mich an die Prüfung nicht mehr erinnern, nur an die Aufgabe, zu folgender Frage einen Aufsatz zu schreiben:
»Warum wird die Suppe kalt, wenn man hineinbläst, warum aber werden die Hände warm, wenn man im Winter hineinbläst?« Eine Herausforderung für einen Neunjährigen.
Ich phantasierte etwas, schrieb und schrieb mit der schmerzenden Hand, was auch immer. Als ich nach Hause fuhr, war ich mir sicher, ich hätte die Prüfung nicht bestanden und mein Traum Gymnasiast zu sein, wäre ausgeträumt. Doch ich wurde aufgenommen.
Allzu gern würde ich heute lesen, was ich damals für einen Unsinn geschrieben habe. Aber man wird mein Elaborat nicht lange aufbewahrt, es irgendwann vernichtet haben.
Auf jeden Fall war ich dann doch stolzer Gymnasiast, heilfroh, die langweilige Volksschule verlassen zu können, an die ich nur eine Erinnerung habe, an den Schulhof und die Pausen, in denen es allein darum ging, die »dummen« Mädchen an ihren langen Zöpfen zu ziehen.
5
Ich war gerade richtig gekommen. Schon in Wuppertal war ich gelegentlich zu den Fußballspielen ins Stadion am Zoo gegangen, aber es gab keinen Verein, mit dem ich mich identifizieren konnte. Der WSV existierte noch nicht, und selbst der, der später zu einem kurzen Höhenflug ansetzen sollte, hätte mich wohl kaum begeistert. Wuppertal war keine Fußballstadt, Dortmund schon. Und so ging ich bald ins Stadion »Rote Erde«, das nicht allzu weit von zu Hause entfernt war. Ich kam gerade richtig, denn 1956 und 1957 wurde die Borussia deutscher Meister und ich war dabei. Die Meisterschaft wurde damals noch in einer Endrunde ausgetragen, zwischen der Oberliga West, Süd, Nord und Südwest glaube ich. Und ich erinnere mich vor allem an Spiele gegen den Hamburger SV und den VFB Stuttgart, besonders an ein 4:1 gegen die Schwaben. Warum gerade an dieses Spiel? Vielleicht weil Stuttgart einen Spieler mit nur einem Arm hatte? Sein Bild ist mir heute noch präsent wie wenige andere Bilder. Robert Schlienz hieß er, ein Kriegsversehrter. Mittelläufer war er.
Die Endspiele fanden dann in Hannover und Berlin statt, ich konnte sie nur am Radio verfolgen. Jedenfalls, der BVB gewann die deutsche Meisterschaft, zweimal hintereinander und beide Male mit derselben Mannschaft, deren Aufstellung ich heute noch herunterbeten kann. Viele fremde Namen sind dabei, polnischen Ursprungs, Kinder früher Gastarbeiter, die im Bergbau in die Tiefe abgetaucht waren: Kwiatkowski, der Torwart, Schlebrowski, der rechte Läufer, Michallek, der Mittelläufer, Kelbassa, der Mittelstürmer, daneben Niepiklo, und links außen Kapitulski. Dazu Burgsmüller und Sandmann, die Verteidiger, Jockel Bracht, der linke Läufer, dann Peters und Adi Preißler rechts im Sturm. Ich glaube mich zu erinnern, dass der die krummsten Fußballerbeine von allen hatte.
Diese beiden Meisterschaftsjahre haben mich geprägt und noch heute, da ich seit Ewigkeiten Dortmund nicht mehr aufgesucht hatte, schaue ich in den Exilkneipen in Berlin, dem «Bierkombinat« in Kreuzberg und dem »Kucheleck« in Wilmersdorf, die Spiele des BVB zusammen mit anderen ausgewanderten Dortmundern im Fernsehen an. Der Fußball ist die einzige Verbindung, die ich noch zu meiner Jugendheimat besitze. Und das geht nicht nur mir so.
Und: wir haben kürzlich erneut zwei Meisterschaftsjahre hintereinander gehabt. Das ich das noch einmal erleben durfte!
Doch ich ging nicht nur zu den Spielen ins Stadion »Rote Erde«. Oft fuhr ich mit dem Fahrrad zum Trainingsplatz neben dem Stadion, vernachlässigte so die Hausarbeiten. Ich sah meine »Helden« von nahem, sah sie an einem Pendel, an dem der Ball hing, einer Art Galgen, das Kopfballspiel üben, Freistöße oder Flanken ausführen, das Torwarttraining und vieles mehr. Heini Kwiatkowski, der Torwart, rettete mich eines Nachmittags vor einer Verletzung. Ich hatte gerade mal woanders hingeschaut, da rief er «Vorsicht Ball!« Ich konnte mich noch ducken, ein scharfgeschossener Ball flog haarscharf über mich hinweg.
Ich war immer allein beim Training, ich kann mich an keinen anderen Jungen erinnern, den ich kannte oder dort kennen gelernt hatte. Einzelgänger halt. Alte Männer, die aber womöglich gerade mal vierzig Jahre zählten, aber alt für mich kleinen Jungen, umstanden leicht erhöht, das Trainingsspielfeld. Ab und zu kam einer auf mich zu, flüsterte, »na Süßer, kommste ma mit?« Oder einer fasste mich, der ich auf dem Fahrrad saß, durch die kurzen Hosenbeine an meinen kleinen Schwanz oder am Hintern an. Ich wusste nicht so recht, was sie von mir wollten, fuhr einfach einige Meter weiter, und sie ließen von mir ab.
Jedenfalls war das Stadion »Rote Erde« und der angrenzende Trainingsplatz ein kleines Stück Heimat in der großen mir immer noch fremden Stadt.
6
Wenn wir das Geknatter der Hubschrauber in der Ferne hörten, schossen wir noch einige Male auf unser improvisiertes Tor, nahmen dann den Ball in die Hand, mussten aufhören, Fußball zu spielen. Am Rheinlanddamm gab es gegenüber dem Arbeitsamt einen Landeplatz. Von dort aus konnte man mit dem Hubschrauber nach Brüssel fliegen, mit der Sabena. Ich weiß nicht mehr wie oft am Tag einer landete und abflog. Auf jeden Fall wurden wir nicht häufig gestört. Wir bauten mit Stöckchen zwei Tore in den Rasen und dann ging es los, vielleicht zwölf Jungens waren wir, die in zwei Mannschaften gegeneinander spielten. Als ich mein letztes Jahr in Wuppertal verbracht hatte, waren »wir« ja gerade in Bern Weltmeister geworden und dort spielten wir Ungarn gegen Deutschland nach, und ich spielte lieber für die Ungarn, wollte ein Nandor Hidegkuti sein. Er galt als bester Fußballspieler der 50er Jahre. Erstaunlicherweise spielte das Endspiel von Bern schon gut ein Jahr später in Dortmund keine Rolle mehr. Wir waren einfach zwei Mannschaften, spielten auch nicht BVB gegen Schalke nach, was nah gelegen hätte. Ich gab stets den Lenker im Mittelfeld, wollte wie die Nummer 10 des BVB, Niepliko, spielen. Meine Sternstunde des Fußballs ist mir heute noch vor Augen. Ich bekam ein Zuspiel aus der Abwehr, lenkte den Ball mit der Hacke über meinen Kopf, nahm den Ball Volley und schoss ihn unhaltbar ins Tor, zwischen die Stöckchen. Kurz darauf bin ich in einen Verein eingetreten, Eintracht Dortmund, der in der Eintrachtstrasse eine Halle und ein Spielfeld hatte. Doch im Verein glänzte ich nicht mehr so, immer Training, weniger spielen, das machte mir keinen Spaß, ich vermisste das improvisierte Spiel auf freiem Feld, und die Hubschrauber, vor denen wir, wenn das Rotorengeräusch sich näherte, flüchteten, denn es war natürlich nicht erlaubt, auf dem Landeplatz zu spielen, doch niemand hinderte uns daran.
7
Heute ist alles verschwunden. Der Hubschrauberplatz und das Spielfeld sowie die Halle von Eintracht Dortmund. Das der Landeplatz nicht mehr existieren würde, damit hatte ich gerechnet, als ich nach vieljähriger Abwesenheit Dortmund noch einmal aufgesucht habe, um die Erinnerungen an meine Jugend aufzufrischen und zu verifizieren. Bebaut durch Bürohäuser der Landeplatz, durch einen Versicherungskonzern das Gelände von Eintracht. Vielleicht gibt es den Verein, der mal der größte Sportverein von Deutschland gewesen sein soll, irgendwo anders in der Stadt, aber das geht mich nichts an. Der Ort, wo ich so viele Stunden verbracht habe, selbst Fußball gespielt habe, wo ich Feld-, Hallenhandball und Faustballspiele angeschaut habe, ist einfach nicht mehr da. Es hat mir einen Stich in der Brust gegeben. Erinnerung ruft halt bisweilen Schmerz hervor.
NordPark Verlag
Literarische Texte und Texte zur Literatur
Die Titel des Nordpark-Verlages können über jede gute Buchhandlung bezogen werden.
Dort berät man Sie gern.
Sollte keine in Ihrer Nähe sein, schicken Sie Ihre Bestellung einfach an uns:
N o r d P a r k
V e r l a g
Alfred Miersch
Klingelholl 53
D-42281 Wuppertal
Tel.: 0202/ 51 10 89
Fax: 0202/29 88 959
E-Mail: miersch@nordpark-verlag.de
Webmaster: Alfred Miersch